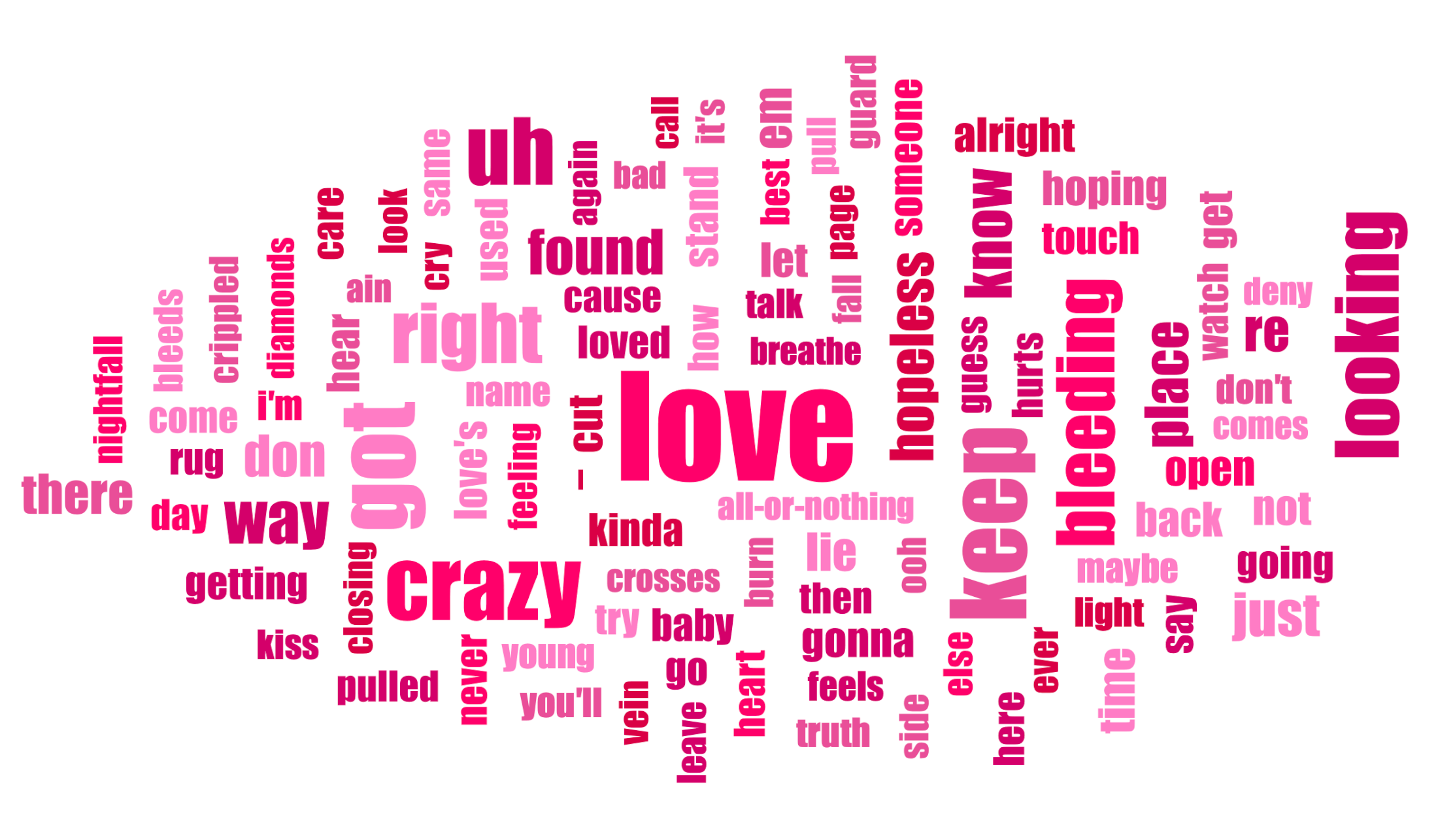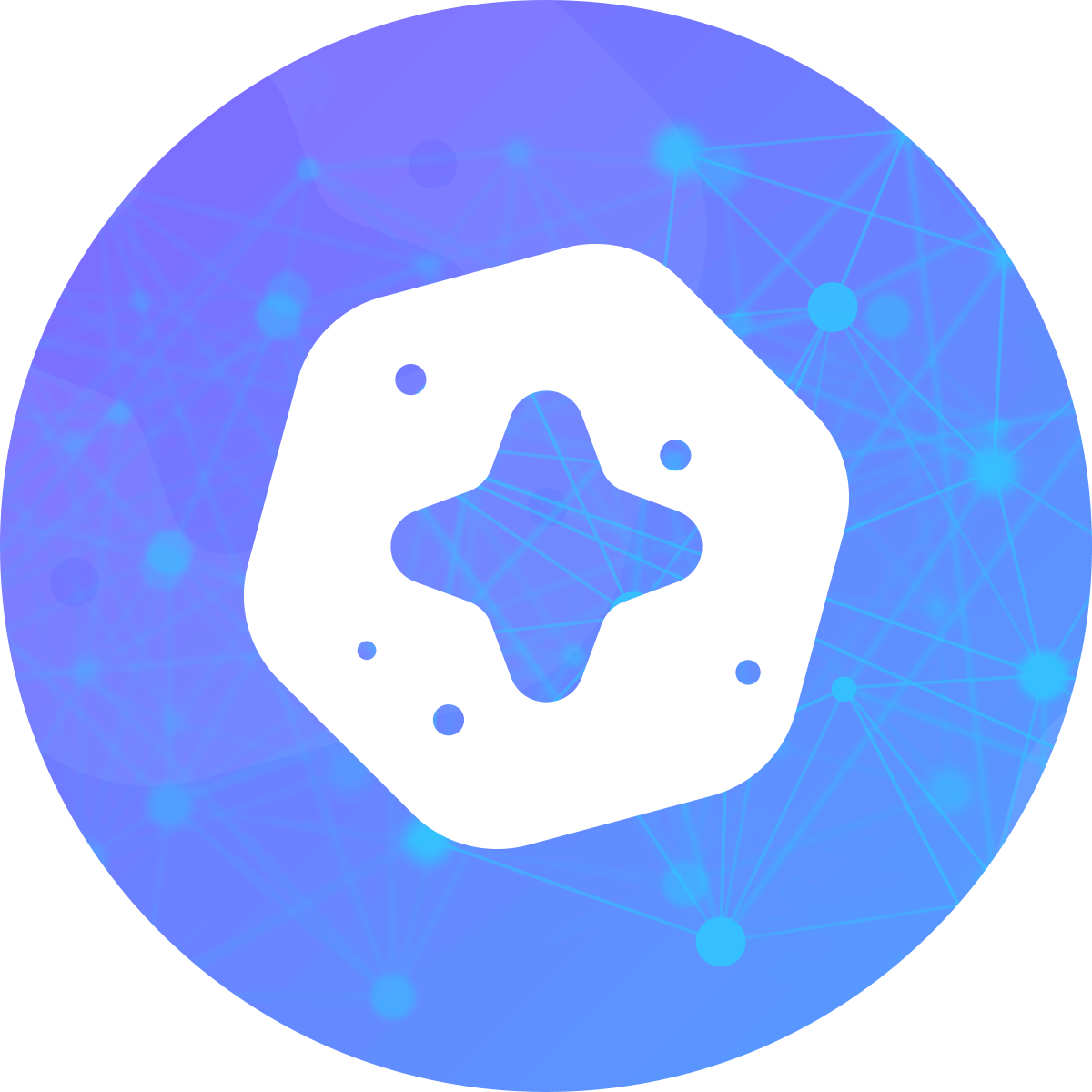Philip Boddin ist Lehrer an einem Berliner Gymnasium und bringt in einem spannenden Projekt Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II wissenschaftliches Arbeiten näher. Um den Jugendlichen ein besseres Verständnis von Forschung zu vermitteln, nutzen sie gemeinsam MAXQDA, um ihre eigenen qualitativen Daten zu analysieren. In einem Interview erzählt er uns von seiner Motivation und der überraschend unkomplizierten Umsetzung, die Schülerinnen und Schüler für das wissenschaftliche Arbeiten zu animieren.
Interview mit Philip Boddin – August 2016
Lieber Herr Boddin, Sie wollen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II Forschung näher bringen – warum?
Das Ziel ist es, die Jugendliche methodisch flexibler zu machen und diese zu befähigen, zielorientiert zu arbeiten. Im Schulalltag kam es häufig vor, dass die Schülerinnen und Schüler wenig zielführende Literatur oder Methoden verwendeten und im schlimmsten Fall wikipedia-artig ein Fachbegriffeglossar erstellen. Hier setzt die Idee an.
Warum nutzen Sie ausgerechnet MAXQDA, um Jugendlichen Forschung näherzubringen?
Wie so oft üblich im Leben, genießt MAXQDA bei mir persönlich Bestandsschutz. Während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter damit in Berührung gekommen und nun zurückerinnert, war die Entscheidung nicht schwer. Ich brauchte ein möglichst einfach zu bedienendes Werkzeug, um viele Interviews und offene Fragen auszuwerten.

Schülerinnen und Schüler vom Berliner Max-Delbrück-Gymnasium lernen MAXQDA
Denken Sie, das Arbeiten mit einer Software erleichtert das Heranführen der Schülerinnen und Schüler an qualitative Forschung?
Davon ist stark auszugehen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es sonst schlicht nicht denkbar oder möglich, offene Frage zu stellen, die über das bloße Ankreuzen hinausgehen. Der Blickwinkel wird somit weiter, die Möglichkeiten größer.
Wie nehmen die Schülerinnen und Schüler MAXQDA an? Wie gestalteten sich die ersten Arbeitsschritte? Welche Reaktionen gab es?
Das ist alles relativ unkompliziert. Die Bildschirmaufteilung ist schnell erklärt, ebenso wie das Prinzip des Codierens und der Sinn dahinter. Kaum ausgesprochen – bzw. eigentlich noch während der Erklärung – fingen die Schüler an zu codieren. Absprachen werden schnell getroffen. Das Wichtigste ist eher die Einhaltung von Codierstandards, die sorgfältige Dokumentation von Codierregeln und vor allem, den Überblick zu bewahren. Das Technische gelingt unkompliziert und bedarf lediglich der Hilfestellung durch einfache Tipps. Natürlich nutzen wir nur einen Bruchteil des Funktionsumfangs, aber das genügt in jedem Fall, um auf einem vernünftigen Niveau qualitative Daten auszuwerten.
Für Schülerinnen und Schüler heute ist die computergestützte Arbeit in jeglicher Hinsicht alltäglich. Sehen Sie Unterschiede im Umgang mit Software von sog. Digital Natives und bspw. Ihrer Generation?
Die Fragestellung suggeriert etwas, dass ich nicht zwingend unterschreiben möchte. Es sind Kinder und Jugendliche, die ein hohes Niveau an Benutzerfreundlichkeit gewohnt sind und überwiegend Kommunikations- und Spiele-Apps nutzen. Wenn es um Anwendungs- und Bürosoftware oder leichte Programmiersprache geht, ist der Umgang gar nicht so alltäglich. Hier bedarf es der gleichen Erklärungen, wie ich das beispielsweise in IT-Kursen aus der Uni kennengelernt habe.
Kurz gesagt, die Schülerinnen und Schüler können insofern als Digital Natives bezeichnet werden, da es kaum Berührungsängste mit der Software gibt. Es wird viel ausprobiert und schnell sind die Mausbewegungen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber in manchen Hinsichten sind die Jugendlichen eben auch Digital Chaots: Faktoren wie eine gute Organisation und das vertiefende Einarbeiten in ein Programm braucht auch Zeit.
Welche MAXQDA Tools sind für die ersten Schritte im wissenschaftlichen Arbeiten an Schulen besonders hilfreich?
Das sind gar nicht so viele. In der Schule bedarf es nur einer Basis-Version, die vom Umfang sehr reduziert ist. Das Codieren von Texten und Audiodateien ist für die erste Quantifizierung von qualitativen Daten schon sehr viel Wert. Auch das Textretrieval ist sehr nützlich, um Aussagen beispielhaft mit geeigneten Textpassagen zu belegen. Unerlässlich sind die Teamarbeitsfunktionen, also das Zusammenführen von Codings von ein und derselben Dokumentgruppe. Nur mithilfe dieser Funktion ist es auch sinnvoll, mit so vielen Schülern gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Für alles andere fehlt schlicht Zeit im eng gesteckten Lehrplan.
Würden Sie die Arbeit mit MAXQDA an Schulen weiterempfehlen? Falls ja: Was haben Sie für Ihre eigene Arbeit als Lehrer mitgenommen? Was würden Sie vielleicht anders machen?
Ich kann die Arbeit mit MAXQDA sehr empfehlen, vor allem, weil es weit weniger aufregend umzusetzen ist, als es anfangs scheint. Eine kurze technische Einführung und Zielorientierung genügt schon, um schnell erste Ergebnisse zu produzieren.
Wir bedanken uns bei Philip Boddin für den Einblick in dieses Projekt und wünschen viel Erfolg für die Zukunft!
Über Philip Boddin

Philip Boddin unterrichtet Mathematik und Geographie am Max-Delbrück-Gymnasium.
Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft bringt er Schülerinnen und Schülern die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens näher. In einem eigenständigen Forschungsprojekt werten die Jugendlichen auch qualitative Daten aus, wofür die Gruppe gemeinsam MAXQDA anwendet.